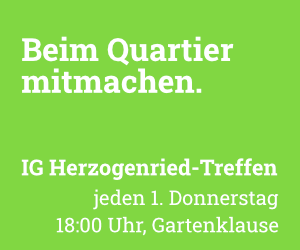Black Forest – Leseabend mit Wolfgang Schorlau
Am dritten Leseabend zur Feier des 50. Geburtstag von Stadtbibliothek und Viertel Herzogenried versammelten sich am 10.10.25 etwa 60 Menschen in der Bücherei.
Zu Gast war der Politkrimiautor Wolfgang Schorlau. Er meinte, er freue sich besonders, wieder einmal in Mannheim zu sein. Das erste Mal sei 2003 gewesen nach dem Erscheinen seines ersten Dengler Romans Die Blaue Liste. In die Zentralbibliothek kamen damals 3 Gäste, zwei davon wären seine Freunde gewesen.
An diesem Abend jetzt las er aus Black Forest, dem elften Roman um den Privatermittler Georg Dengler aus Stuttgart.
Schorlau greift in seinen Büchern stets Themen auf, die uns als Gesellschaft bewegen, die wichtig für uns sind, die aber oft unklare Seiten haben und deren komplexe Zusammenhänge unterschiedlich interpretiert werden können. Er liefert einen neuen, aufklärerischen Blick auf die Dinge. Sie könnten auch anders sein bzw. sie könnten anders gewesen sein. So beschreibt der Roman Die blaue Liste eine Geschichte, wie sich die Arbeit der Treuhand und damit die Umwandlung der DDR Industriebetriebe hätte anders – weniger gewaltsam – gestalten können. Der Roman Münchenkomplott untersucht das rechtsradikale Attentat auf das Oktoberfest 1980 mit den Verwicklungen von In- und Ausländischen Geheimdiensten und in Die schützende Hand geht es um die unklaren Punkte bei den Morden und Prozessen des NSU.
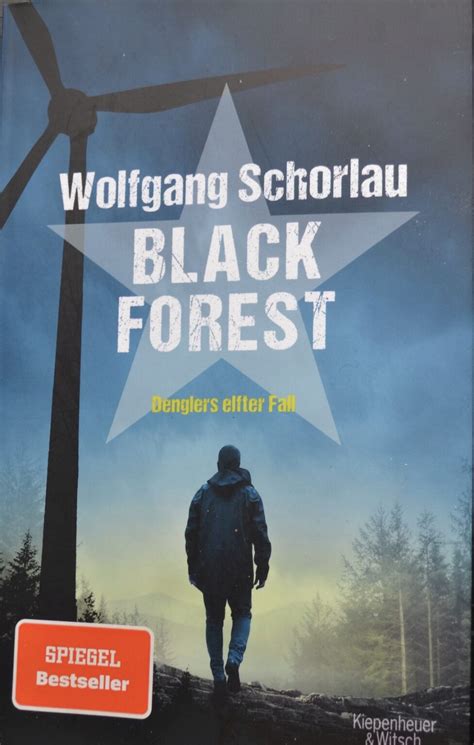
Thema im Roman Black Forest sind der Klimawandel und die Klimapolitik.
Denglers Mutter besitzt neben ihrem Hof ein Weidegrundstück auf dem Feldberg und eben für dieses Grundstück gibt es das Angebot eines Windradbauers, dort ein Windrad aufzustellen.
Wolfgang Schorlau ist bekannt für seine detaillierte Recherche. Ungefähr 2 Jahre arbeitet er an einem Roman. Er liest sich detailliert ein, spricht mit Beteiligten und Kontrahenten.
So hatte er für Black Forest Kontakt mit verschiedenen lokalen Gruppen von Windkraftgegnern. Er bedankt sich im Nachwort für den offenen Austausch von Argumenten, bekennt aber auch, dass sie ihn nicht überzeugt hätten.
Stattdessen räumt er im Roman mit Argumenten auf wie ‚Windräder töten Vögel‘.
Ja, die 10000 Windräder in Deutschland töten etwa 30000 Vögel im Jahr, aber das ist nichts gegen den Tod von 115 Millionen Vögeln, die an Fenster zerschellen oder bis zu 60 Millionen, die von Katzen gefressen werden.
Er schildert auch, wie wunderbarer Weise immer dann, wenn an einer Stelle im Schwarzwald ein Windrad gebaut werden sollte, Auerhahnkot auf dem Gebiet auftauchte und Naturschutz erzwang. Eine genetischen Untersuchung ergab, dass es sich stets um das gleiche Tier gehandelt hatte, dessen Kot immer gezielt an den passenden Stellen ausgebracht wurde.
Und dann gibt es natürlich nicht nur lokale Gegner der Windkraft, sondern auch die Vertreter der Fossilen Industrien.
In diesem Zusammenhang begegnet uns im Roman eine Person wieder, die die Leser*innen der Dengler Romane schon aus Fremde Wasser kennen: Stephan C. Crommschröder. In Fremde Wasser ging es um die Aneignung von kommunalen Wasserwerken durch die Industrie, jetzt geht es um die Verhinderung der Energiewende, insbesondere der lokalen Energiewende.
Crommschröder hat nicht prinzipiell etwas gegen Windkraft, sein Unternehmen baut in der Nordsee große Windparks. Aber er hat etwas gegen lokale Energieerzeugung, unabhängig von seinem Konzern, die die Profite seines Unternehmens minimiert. Und in diesem Zusammenhang heißt es: es darf kein Windrad auf dem Feldberg geben, dem Kultberg des Schwarzwalds.
Und natürlich muss weitere Klimapolitik auf großer Ebene verhindert werden.
Lange vor der Wahl im Frühjahr 2025 beschrieb Schorlau die Wünsche der Industrie in dieser Richtung.
Obwohl 75 % der Bevölkerung den Klimawandel bedrohlich finden und er für 70% ein wichtiges Thema in der Politik ist, unterscheiden sich die Meinungen zwischen den verschiedenen Gruppen der Bevölkerung deutlich, wenn es um konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel geht.
Die untere Hälfte der Einkommen fürchtet, dass die Kosten einer Klimapolitik vorrangig bei ihnen abgeladen würden, obwohl sie nicht die primären Verursacher sind. „Die entscheidenden Emissionstreiber in Privathaushalten sind Konsum und Ausgaben der Reichen und Superreichen. … Und wenn man das politische Klima des Landes grundsätzlich ändern wolle, dann müsse man das Misstrauen der unteren 50 Prozent gegenüber der Klimapolitik nutzen, um die ökologisch bewusste untere Mittelschicht zu isolieren. Man müsse sie dazu bringen, Parteien zu wählen, die mit dem Klimawahnsinn aufräumen würden.“ (Black Forest, S.296 ff.)

In dieses Spannungsfeld geraten nun die Protagonisten des Romans: Denglers Mutter Margaret, Dengler selbst und seine Freundin Olga, sein Sohn Jakob und dessen Freundin Laura.
Die Freunde aus Stuttgart, dem Sitz der Detektei Dengler, spielen in diesem Roman keine Rolle: Mario, Künstler und Koch, Leopold, Journalist, Martin, Lebenskünstler.
Nur Olga, die Pippi Langstrumpf für Erwachsene, wie Schorlau sie gerne nennt, ist dabei und bringt wieder ihre Fähigkeiten auf den verschiedensten Gebieten ein.
Wenn Sie das Buch noch nicht kennen, lassen Sie sich überraschen, wie sich die Geschichte entwickelt. Nur eines vorab: Am Ende soll es ein Windrad auf dem Feldberg geben.

In der Realität wird darüber noch heftig diskutiert. Dabei – so Johannes Albrecht, Bürgermeister der Gemeinde Feldberg – könnten 3 Windräder auf dem Feldberg so viel Strom erzeugen wie 15-20 Windräder auf mittleren Höhen.

Wolfgang Schorlau liest sehr unterhaltsam eine Stunde und signiert danach gerne seine Bücher.
Man könnte sich wünschen, dass er nicht nur vor einem Publikum wie an diesem Abend liest, sondern auch vor jungen Leuten, vielleicht in Schulen.
Seine Bücher schlagen uns mit den Mitteln des Krimis in den Bann, sind aber gleichzeitig im wahrsten Sinn des Wortes aufklärerisch. Und auf dem Hintergrund seiner eigenen Geschichte könnte er für Jugendliche, die sich als ‚nicht so privilegiert‘ empfinden, ein Beispiel sein.

Schorlau wurde 1951 geboren und kam – nach eigenen Worten – nach 9 Jahren dumm aus der Volksschule. Er machte eine Lehre als Großhandelskaufmann und geriet in die Umbruchzeiten 1966 bis 69. Damals rekrutierten in Freiburg Studenten die Arbeiter und alle lasen zusammen Marx, Lenin, Traumdeutung, französische Existentialisten. Das zu können und zu verstehen überzeugte ihn, nicht dumm zu sein. Er erwarb mit dem Begabtenabitur die Zulassung zur Universität und schrieb sich für Soziologie und Geschichte Osteuropas ein, fand das Studium dann aber zu wenig anregend. In Zeiten einer boomenten IT-Kultur ging er zu Nixdorf, machte eine Ausbildung in Informatik und arbeitete sich in die Fragen industrieller Produktion ein. Später gründete er mit einem Freund ein kleines Softwareunternehmen, dessen Anteile er Anfang der 2000er Jahre verkaufte. Er wollte etwas anderes tun, etwas anderes, was wichtig war. Und dann kamen aus verschiedensten Richtungen die Impulse für seinen ersten Roman Die blaue Liste und der Erfolg Dengler Romane begann.
Text: Monika Schleicher
Fotos: Irmgard Rother und Michael Baier